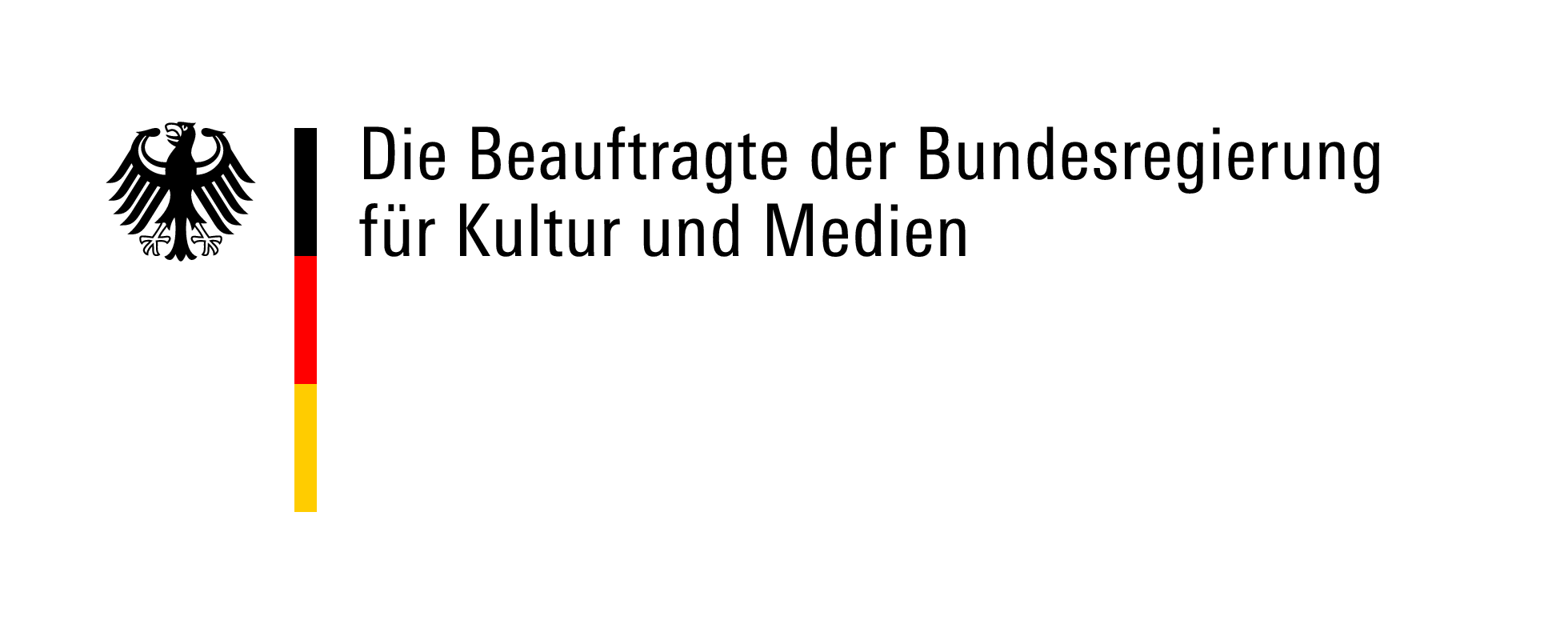tanz:digital FAQs Rechte
- Was sind Urheberrechte?
- Woran gibt es Urheberrechte?
- Wer hat alles Urheberrechte?
- Haben auch Tänzer*innen, Sänger*innen und andere Darsteller*innen Urheberrechte?
- Was sind Verwertungsrechte, was sind Nutzungsrechte (Lizenzen), wer hat diese und wie bekomme ich sie?
- Was mache ich bei Werken / Stücken, an denen mehrere Urheber*innen beteiligt waren?
- Welche Rechte muss ich einholen, um ein Video hochzuladen?
- Welche Rechte muss ich einholen, um ein Foto hochzuladen?
- Welche Rechte muss ich einholen, um Fotos in Artikeln zu verwenden?
- Muss ich immer Rechte bei den Urheber*innen einholen oder gibt es (gesetzliche) Ausnahmen?
- Kann ich auf urheberrechtliche Materialien mit Hyperlinks verlinken oder diese auf meiner Seite embeden (einbetten)?
- Muss ich bei alten Werken auch Rechte einholen? Wann muss ich keine Urheberrechte mehr berücksichtigen?
- Wie und in welcher Form muss ich die benötigten Rechte einholen?
- Muss ich einen schriftlichen Vertrag abschließen, um die Rechte einzuholen?
- Wer kümmert sich um die Bezahlung der GEMA?
- Wer kümmert sich um die weiteren Verwertungsgesellschaften wie VG Bild-Kunst sowie VG Wort?
- Welche Sprache benutze ich bei Verträgen?
- Welches Recht gilt bei internationalen Kollaborationen?
Was sind Urheberrechte?
Mit dem Urheberrecht sind gesetzliche Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums und ihrer Verwertung / Nutzung gemeint. Das Urheberrecht gibt Urheber*innen Rechte und schützt sie auch vor unerlaubten Eingriffen in diese Rechte. Es regelt zudem die (weitere) Verwertung der urheberrechtlich geschützten Werke.
Woran gibt es Urheberrechte?
Urheberrechte gibt es an Werken. Erfüllt ein Werk die Voraussetzungen des Urheberrechts, gilt es als urheberrechtlich geschützt. Dafür sind gemäß dem deutschen Urheberrechtsgesetz die Entstehung durch eine persönliche schöpferische Leistung des/der Urheber*in und eine gewisse Originalität des Werkes notwendig. Dies ist im Rahmen von z.B. Tanzstücken aber schnell erreicht. So fällt die Choreographie in den allermeisten Fällen unter den Werkbegriff, aber in der Regel auch die Musik, das Bühnenbild usw. Ein Urheberrecht muss nicht angemeldet werden, es entsteht automatisch mit der Schöpfung des Werks.
Wer hat alles Urheberrechte?
Urheber*in ist jede*r Schöpfer*in eines Werkes. Hierunter fallen u.a. Choreograf*innen, Autor*innen, Lichtdesigner*innen, Komponist*innen und jede weitere natürliche Person, die aufgrund eines kreativen Schaffensprozesses ein Werk geschaffen hat, also z.B. auch Kinder.
Haben auch Tänzer*innen, Sänger*innen und andere Darsteller*innen Urheberrechte?
Darstellende Künstler*innen haben, so lange sie nicht auch an der Schaffung des Werkes beteiligt waren, im Zweifel keine Urheberrechte am jeweiligen Werk. Sie haben aber sogenannte Leistungsschutzrechte. Das heißt, auch sie haben Rechte, die es zu beachten und gegebenenfalls auch zu bezahlen gilt. Sie werden quasi für ihre Mühe „belohnt“. Wenn also ein Video von darstellenden Künstler*innen aufgenommen wird, müssen sie gefragt werden; auch, ob es dann weiter vertrieben/genutzt werden darf. Dies sollte immer vertraglich festgehalten werden.
Was sind Verwertungsrechte, was sind Nutzungsrechte (Lizenzen), wer hat diese und wie bekomme ich sie?
Verwertungsrechte stehen den Urheber*innen als Teil des Urheberrechts zu und sind in den §§ 15 - 23 UrhG geregelt. Hierzu gehören zum Beispiel auch das „Streamingrecht“ (Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19 UrhG). Laut § 15 UrhG haben Urheber*innen das ausschließliche Recht, ihre Werke in körperlicher oder unkörperlicher Form zu verwerten. Es ist möglich, Nutzungsrechte (auch Lizenzen genannt) entsprechend dieser Verwertungsrechte von den Urheber*innen zu erhalten. Da die häufigsten Nutzungsarten erst mit den Urheber*innen abgesprochen werden müssen, sollten Sie sich die Regelungen vor einer Nutzung genau anschauen und entsprechende Lizenzen einholen.
Was mache ich bei Werken / Stücken, an denen mehrere Urheber*innen beteiligt waren?
Bei mehreren Urheber*innen kann es sich um „verbundene Werke“ (§9 UrhG) oder einem Werk mit mehreren Urheber*innen (Miturheberschaft § 8 UrhG) handeln. Bei verbundenen Werken haben mehrere Urheber*innen ihre Werke zur gemeinsamen Verwertung/ Nutzung miteinander verbunden. Bei einer Tanzaufführung wären das z.B. die Lichtdesignerin, die als Werk ein Lichtdesign erschaffen hat und die Choreographin, die eine Choreographie entwickelt hat. Beide haben ein urheberrechtlich relevantes Werk geschaffen, welches sie für das Tanzstück verbunden haben. Sie könnten die einzelnen Werkteile auch anderweitig nutzen, sie sind also nicht unlösbar miteinander verbunden. Haben mehrere Urheber*innen ihre Werke zu gemeinsamer Verwertung miteinander verbunden, so kann jeder vom anderen die Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung und Änderung der verbundenen Werke verlangen, wenn die Einwilligung dem anderen nach Treu und Glauben zuzumuten ist. Bei der Miturheberschaft liegt insgesamt nur ein Werk vor, das von mehreren Urheber*innen geschaffen wurde. Die einzelnen Beiträge der Miturheber*innen können nicht isoliert verwertet werden und sind oft nicht klar voneinander trennbar. Hier steht das Recht zur Veröffentlichung und zur Verwertung des Werkes den Miturheber*innen „zur gesamten Hand“ (nur gemeinschaftlich) zu und Änderungen des Werkes sind nur mit Einwilligung der Miturheber*innen zulässig. Ein*e Miturheber*in darf die Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung oder Änderung nicht wider Treu und Glauben verweigern. Wenn etwas anderes gewollt ist, muss dies vertraglich festgehalten werden. Wenn also nur eine Person (z. B. Choreograf*in) ein gemeinsam geschaffenes Werk (z. B. Tanzstück) verwerten soll, sollte das klar geregelt werden.
Welche Rechte muss ich einholen, um ein Video hochzuladen?
Bei Videoaufnahmen können Sonderregelungen greifen. Auch hier stellt sich zunächst die Frage: Wer hat künstlerisch an dem Video mitgewirkt? Habe ich alle Personen bedacht und vertraglich festgehalten, dass ich sie oder ihr Werk filmen/filmisch verwerten darf und dann auch weiter nutzen darf (Lizenzen)? Bei Personen, die am Film mitarbeiten, greift die Vermutung des § 89 UrhG wie folgt: Wer sich zur Mitwirkung bei der Herstellung eines Filmes verpflichtet, räumt damit für den Fall, dass er*sie ein Urheberrecht am Filmwerk erwirbt, dem*der Filmhersteller*in im Zweifel das ausschließliche Recht ein, das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere filmische Bearbeitungen oder Umgestaltungen des Filmwerkes auf alle Nutzungsarten zu nutzen. Die Urheberrechte an den zur Herstellung des Filmwerkes benutzten Werken, wie Roman, Drehbuch und Filmmusik, bleiben unberührt und müssen immer noch eingeholt werden. Um die Arbeit auf tanz:digital hochzuladen, müssten insbesondere die Lizenzen für die öffentliche Zugänglichmachung eingeholt worden sein (§ 19a UrhG). Welche weiteren Nutzungsrechte an tanz:digital übertragen werden müssen, stehen in den Nutzungsbedingungen. Besonders bei der Einholung von Musikrechten (insb. sogenannte Filmherstellungsrechte) sollte frühzeitig hieran gedacht werden, da der Kontakt mit den Musikverlagen und/oder Urheber*innen lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Sind außerdem noch eventuelle Leistungsschutzrechte der Tänzer*innen und Sänger*innen beachtet worden?
Welche Rechte muss ich einholen, um ein Foto hochzuladen?
Bei einem Foto sind zunächst die Nutzungsrechte (Lizenzen) bei der*dem Fotograf*in einzuholen. Zudem müssen evtl. Persönlichkeitsrechte beachtet werden, wenn Personen auf dem Bild zu sehen sind. Im Zweifel wurden vor dem Fotografieren bereits manche Rechte eingeholt, diese müssen sich aber nicht auf alle Nutzungsarten beziehen. Um die Arbeit auf tanz:digital hochzuladen, müssten insbesondere die Lizenzen für die öffentliche Zugänglichmachung eingeholt worden sein (§ 19a UrhG).
Welche Rechte muss ich einholen, um Fotos in Artikeln zu verwenden?
Auch innerhalb von Artikeln und anderen Schriftwerken muss die Erlaubnis für die Nutzung von Fotos von den Urheber*innen eingeholt werden, soweit die Fotos rein zur Illustration genutzt werden sollen. Wenn die Fotos aber als Beleg für eine Behauptung (Zitat) genutzt werden sollen, könnte das Zitatrecht des § 51 UrhG einschlägig sein. Da die Abgrenzung im Einzelfall sehr schwierig sein kann, wäre es immer am sichersten die Erlaubnis einzuholen.
Muss ich immer Rechte bei den Urheber*innen einholen oder gibt es (gesetzliche) Ausnahmen?
Grundsätzlich müssen Urheber*innen bei jeder Verwendung gefragt werden, es sei denn, es greift ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand wie z.B. beim Zitatrecht nach § 51 UrhG oder die Urheber*innen habe ihre Rechte an Verlage, Plattenfirmen oder Verwertungsgesellschaften abgetreten. Dann müssten diese kontaktiert und bezahlt werden.
Kann ich auf urheberrechtliche Materialien mit Hyperlinks verlinken oder diese auf meiner Seite embeden (einbetten)?
Hyperlinks sind in der Regel erlaubt, soweit die verlinkten Inhalte öffentlich (frei) zugänglich sind und nicht etwa hinter einer Bezahlschranke liegen. Zudem darf es sich dabei nicht um illegale Uploads handeln.
Wer einen Link mit Gewinnerzielungsabsicht legt, regelmäßig bei nicht privater Tätigkeit, kann haftbar gemacht werden, wenn dieser Link zu illegal im Internet veröffentlichten Inhalten führt. Hier müssen vor einer Linksetzung Nachprüfungen erfolgen, um sich zu vergewissern, dass das betroffene Werk nicht unbefugt veröffentlicht wurde. Bei Zweifeln sollte daher lieber auf das Verlinken verzichtet werden.
Beim embeden ist die Rechtslage komplizierter. Erlaubt sind häufig Linksetzungen von Videoportalen, da diese es ausdrücklich in ihren Nutzungsbedingungen erlauben, z.B. bei Vimeo. Hier sollten die Nutzungsbedingungen vor der Einbettung genau durchgelesen werden. Hat der*die Urheberrechtsinhaber*in beschränkende Maßnahmen gegen Framings getroffen oder veranlasst, ist die Einbettung eines Werks in eine Website eines Dritten via Framing nur mit Erlaubnis des*der Urheberrechtsinhaber*in zulässig.
Muss ich bei alten Werken auch Rechte einholen? Wann muss ich keine Urheberrechte mehr berücksichtigen?
Das Urheberrecht erlischt erst 70 Jahre nach dem Tod des*der Urheber*in. Das heißt, bis dahin müssen die Rechte, evtl. dann bei den Erben des*der Werkersteller*in, eingeholt werden. Oft haben sich aber auch z.B. Verlage und Produktionsfirmen die Nutzungsrechte einräumen lassen, weshalb zunächst bei diesen angefragt werden sollte. Vorsicht bei Übersetzungen: Zwar kann der*die ursprüngliche Urheber*in bereits seit über 70 Jahren verstorben sein, aber die Übersetzung, welche im Zweifel ebenfalls Urheberrechtsschutz erfährt, muss noch nicht „verjährt“ sein.
Wie und in welcher Form muss ich die benötigten Rechte einholen?
Bei einem noch zu erstellenden Werk, wenn die Produktion also erst am Anfang ist, sollten bei bestehendem persönlichen Kontakt zu den Urheber*innen die Rechte auch unmittelbar von diesen eingeholt und schriftlich festgehalten werden. Manchmal liegen die Rechte aber auch bei z. B. Archiven, Verlagen, Produktionsfirmen, Erben oder Verwertungsgesellschaften (z. B. GEMA). Die Rechte sollten vor Beginn der eigenen Arbeit eingeholt werden, da sie nicht immer eingeräumt werden oder zu teuer sein könnten und dann auf Alternativen zurückgegriffen werden muss, um die eigene Arbeit erstellen und veröffentlichen zu können.
Muss ich einen schriftlichen Vertrag abschließen, um die Rechte einzuholen?
Die meisten Verträge müssen nicht schriftlich abgeschlossen werden und sind formfrei. Das heißt, sie können auch mündlich, telefonisch, per E-Mail, SMS oder in manchen Fällen sogar stillschweigend abgeschlossen werden.
Es gibt allerdings Ausnahmen. Förderinstitutionen verlangen zum Teil schriftliche Verträge. Schriftform fordert auch der Tarifvertrag für Theater des Deutschen Bühnenvereins (Normalvertrag Bühne).
Sollten Sie sich also mündlich auf eine freie Zusammenarbeit einigen, ist das schon für beide Seiten verbindlich, auch wenn (noch) nichts unterschrieben wurde. Das gleiche gilt dann auch für die Urheber- und Leistungsschutzrechte, die benötigt werden, um Material auf tanz:digital hochzuladen. Aus Beweis- und Transparenzgründen sollten dennoch immer alle Absprachen schriftlich festgehalten werden. Somit können auch Missverständnisse vermieden werden. Es sollte daher z.B. schriftlich oder per E-Mail (Textform) klar geregelt werden, welche Nutzungsrechte eingeräumt werden.
Wer kümmert sich um die Bezahlung der GEMA?
Für das Hochladen und Streaming von Videoproduktionen der Nutzer*innen auf der Plattform tanz:digital, die mit Erlaubnis der Urheber*innen oder GEMA erstellt wurden, hat der Dachverband Tanz eine Vereinbarung mit der GEMA getroffen und zahlt diese. Das heißt jedoch nicht, dass für die Nutzung von Musik in dem Video selbst und für andere Nutzungsarten nicht vorher auch ein eigener Vertrag mit der GEMA oder den Urheber*innen abgeschlossen werden musste. Dies ist am besten unmittelbar bei der GEMA und den Urheber*innen zu erfragen.
Bei Einbettungen von Links über Vimeo, zahlt Vimeo bereits einen Betrag an die GEMA.
Wer kümmert sich um die weiteren Verwertungsgesellschaften wie VG Bild-Kunst sowie VG Wort?
Hier müssen Sie sich selbst darum kümmern nachzuprüfen, ob für die Nutzung von Bildern und Texten evtl. weitere Verwertungsgesellschaften betroffen sind. Sie können dafür einfach Kontakt mit den Verwertungsgesellschaften aufnehmen.
Welche Sprache benutze ich bei Verträgen?
Es ist Ihnen freigestellt, welche Sprache Sie beim Abschluss von Verträgen nutzen. Sie sollten aber eine Sprache wählen, die alle Vertragsparteien gut verstehen. Der Vertrag kann auch mehrsprachig sein, z.B. einmal komplett auf Deutsch, dann im Anschluss noch einmal ins Englische übersetzt. Hier sollten Sie aber im Vertrag eine Sprache als die verbindliche erklären, z.B. weil durch Übersetzungsfehler andere Ergebnisse je nach Sprache herauskommen können.
Welches Recht gilt bei internationalen Kollaborationen?
Bei internationalen Kollaborationen und internationalen Verträgen sind unterschiedliche Rechtsordnungen betroffen. Deshalb wird es einem in Deutschland ebenso wie in den meisten anderen Ländern der Welt freigestellt, welchem Landesrecht der Vertrag unterstellt werden soll. Sogar die Vereinbarung eines „neutralen” Rechts wird vielerorts akzeptiert. Erst wenn eine solche ausdrückliche Rechtswahl nicht erfolgt, muss jedes Land selbst im Rahmen sogenannter Kollisionsnormen entscheiden, welches Landesrecht bei Verträgen mit Auslandsberührung anwendbar sein soll. Da dies recht kompliziert ist, sollte im Vertrag immer genau festhalten werden, welches Recht (z.B. deutsches Recht) gelten soll. Diese freie Rechtswahl ist aber nicht immer möglich. In manchen Fällen gilt trotz einer Vereinbarung über eine Rechtsordnung das Recht eines anderen Staates, z.B. bei Eigentumsfragen, wo es auf den Standort der Sache ankommt.